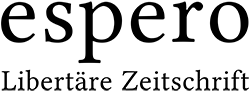Von Michael Hirsch und Kilian Jörg, Hamburg: Nautilus, 2025 (= Nautilus Flugschrift), ISBN: 978-3-96054-393-0, 152 Seiten, 16,00 €. [Direktkauf bei aLibro]
Da sind ja Löcher im Status quo!
„Das System bricht überall um uns herum zusammen
in genau jenem Moment, in dem viele Personen
die Fähigkeit verloren haben, sich das Funktionieren
eines anderen Systems vorzustellen.“
David Graeber, 2018
Was passiert, wenn ein Aktivist der „anarchistischen Bewegungslinken“ und ein Akademiker, der sich als „radikaler Reformist“ versteht und dem sogenannten „progressiven Etatismus“ (S. 14) nahesteht, gemeinsam über den Ausweg aus der ökologischen Krise nachdenken? Die Antwort liefert ihr gemeinsames Buch: Durchlöchert den Status quo! Autonome Zonen, radikale Demokratie und Ökologie, erschienen als Flugschrift bei Nautilus.

Mit den beiden Autoren des Buches, Kilian Jörg und Michael Hirsch, treffen zwei auf den ersten Blick unvereinbar erscheinende politische Gegensätze aufeinander – und finden überraschende Gemeinsamkeiten. Jörg vertraut auf den Aufbruch von unten, auf die Kraft sozialer Bewegungen. Hirsch hingegen glaubt an den Wandel von innen, an die Reformfähigkeit des Staates.
In ihrem Werk rücken die Autoren das Konzept der Zone à défendre (ZAD) ins Zentrum ihrer Überlegungen. Dieses Konzept, das seinen Ursprung in kommunistisch-anarchistischen Bewegungen hat, gewann in Frankreich ab 2008 an Bedeutung im Widerstand gegen den geplanten Flughafenbau im westfranzösischen Notre-Dame-des-Landes. Seither hat es sich zu einer konkreten Praxis und spezifischen Form des Widerstands entwickelt. Ziel ist es, durch die Besetzung realer Territorien staatlich-kapitalistische Strukturen zu unterbrechen und Freiräume für alternative, solidarisch organisierte Lebensformen zu schaffen. „Das heißt: Eine Welt, wie sie sein sollte und zukünftig vielleicht sein könnte, soll in der ZAD bereits im Hier und Jetzt realisiert werden.“ (S. 17) Vor diesem Hintergrund entwickeln Hirsch und Jörg das Konzept eines „strategischen Optimismus“ (S. 13), das als bewusste Alternative zur weitverbreiteten politischen Lähmung und zum Katastrophismus in der Klimadebatte zu verstehen ist.
Zu Beginn ihres Buches diagnostizieren Hirsch und Jörg eine tiefe Krise der politischen Vorstellungskraft. Der Satz „Es gibt keine Alternative“ habe sich demnach zur zentralen Legitimation des neoliberalen Kapitalismus entwickelt. Dieser „frappierende Mangel an mehrheitsfähigen Vorstellungen anderer und besserer Weltenordnungen führt zu der paradoxen Situation, dass selbst hohe Würdenträger*innen wie der UN-Generalsekretär oder der Papst die katastrophale Lage der Welt eingestehen“, sich aber „trotzdem rein gar nichts am kapitalistischen System ändert” (S. 5). Die Veränderungsfähigkeit des Systems scheint sich auf das Präfix „grün” zu beschränken, das inflationär fast jeder Branche und Institution verliehen wird.
In der aktuellen Klimadebatte kritisieren die Autoren zwei gegensätzliche Haltungen: den Techno-Optimismus in Politik und Wirtschaft sowie den Katastrophismus im Ökoaktivismus. Ersterer setzt auf technische Lösungen, die Probleme jedoch oft verschärfen, anstatt sie zu lösen. Letzterer arbeitet mit Schock und Panik, um Menschen zu mobilisieren. Doch beides greift zu kurz. Den Kapitalismus betrachten die Autoren zudem nicht nur als Motor wachsender Ungleichheit, sondern auch als ein System, das Unsicherheit produziert. Wird diese systemische Unsicherheit – und die mit ihr verbundenen negativen Affekte wie Wut, Verzweiflung, Frustration, Ressentiment – noch durch alarmistischen Aktivismus zusätzlich befeuert, könnte dies die Grundlage für die Stärkung reaktionärer, demagogischer und faschistischer Kräfte bilden. Warnend weisen sie darauf hin, dass die Verzweiflung der Türöffner zum Faschismus ist, besonders wenn es an vorstellbaren positiven Alternativen mangelt.
Als Ausweg aus der Lähmung der politischen Vorstellungskraft schlagen Hirsch und Jörg vor, „jenseits des Alarmismus“ konkrete utopische Entwürfe für die Gegenwart zu entwickeln, denn:
„Nur wenn Menschen in Ansätzen erfahren können, wie man auch anders und besser leben kann, wird das angesammelte Bewusstsein zu einem Wandel führen anstatt zu einer weiteren Verhärtung des Bestehenden. (. . .) Es braucht die Arbeit an der Plausibilisierung radikal anderer Lebensweisen, die mehr und mehr Menschen als freud- und hoffnungsvollere Alternativen zum katastrophischen Realismus erscheinen können.“ (S. 10)
Die Autoren stellen die Förderung der (Bio-)Diversität als politisches Ziel an erste Stelle. Sie wird als menschliches und planetarisches Gut verstanden. Vielfalt wird als vital notwendig erachtet und sie betrifft nicht nur die sogenannte Natur und andere Spezies, sondern auch die menschlichen Kulturen selbst.
Hirsch und Jörg sehen in der ZAD nicht nur eine Praxis des Widerstands, sondern auch ein Denkmodell, das dazu beitragen könne, neue Wege zu erkennen und aufzuzeigen, wie Menschen wieder ihre Handlungsfähigkeit erlangen können. Im Unterschied zum traditionellen Anarchismus lehnen sie dabei den Staat nicht pauschal ab. Stattdessen fragen sie, ob die ZAD „eine Art politisches Programm für einen Staat werden“ könnte, der sich seiner eigenen „institutionellen Gelähmtheit bewusst ist und der bereit ist, Auswege aus dieser zu suchen“ (S. 15).
Ausgehend vom Modell der ZAD entwickeln sie die Idee eines „neuen linken Patchwork-Utopismus“ (S. 15) oder, in Anlehnung an die Zapatistas, eine Strategie des Multimondialismus. Dabei geht es nicht mehr darum, die eine bessere Welt zu erkämpfen, wie das viele frühere Utopie-Projekte versucht haben, sondern darum, die größtmögliche Vielfalt von Lebensweisen und Welten zu ermöglichen.
Hirsch und Jörg lassen uns mit ihrem Buch in eine Zukunft schauen, in der auf unserem Planeten viele unterschiedliche Welten nebeneinander bestehen – frei von einer übergeordneten Ordnung. Vielmehr sollen vielfältige, auch widersprüchliche Lebens- und Gesellschaftsformen gleichzeitig möglich sein. In Anlehnung an die anarchistische Utopie bolo’bolo von P. M. (Hans Widmer) nennen die Autoren ihren Ansatz die „Bolo’boloisierung der Politik” (s. S. 85-94), worunter sie das Aufbrechen monolithischer Ordnung zugunsten einer Vielfalt dezentraler und selbstbestimmter Lebensformen verstehen.1
Das heutige System der repräsentativen Demokratie, wie wir sie in den westlichen Industriestaaten kennen, kritisieren sie als unzureichend, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der ökologischen Katastrophe. Stattdessen plädieren die Autoren für eine Weiterentwicklung der Demokratie, die sich an den Basisbewegungen und der Selbstorganisation von unten orientiert, was den libertären Charakter ihres Konzeptes verdeutlicht.
Ein zentrales Thema des Buches ist die Auseinandersetzung mit Staat, Recht und Eigentum (s. S. 116-122). Die Autoren argumentieren für eine „Durchlöcherung“ des Staates, worunter sie verstehen, ihn von innen heraus zu verändern und für progressive Ziele zu nutzen. Aus der Sicht des Old-School-Anarchismus mag eine solche Ansicht ziemlich ketzerisch erscheinen. Doch trägt sie letztlich nur einem differenzierteren Staatsverständnis der heutigen Libertären Rechnung. Denn auch die Libertären haben sich inzwischen in den Strukturen des modernen Staates eingerichtet und bedienen sich seiner Mittel. Man denke nur an die stark angewachsene akademische Anarchismusforschung oder an zahlreiche libertäre Kulturprojekte, die von staatlicher Förderung abhängig sind. Nicht zuletzt arbeiten viele Libertäre selbst im Staatsdienst, etwa als Lehrkräfte oder Sozialarbeiter:innen.
Auch das Recht und das Eigentum betrachten die Autoren nicht als unveränderliche Größen, vielmehr plädieren sie dafür, die „diversen und disparaten Elemente des bestehenden Rechts weiterzuentwickeln“, um sie im Sinne einer Ökologisierung der Gesellschaft nutzbar zu machen. Und was das Eigentumsrecht anbelangt, so betonen sie, dass dieses stets ein „lebendiger Prozess der Anpassung an gegenwärtig herrschende Wertregime“ (S. 101) war und sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert hat. Präfigurative Ansätze wie die ZAD können als eine Wiederbelebung vergessener kommunaler Modelle des Eigentumsbegriffes verstanden werden und sie laden zu einer Reform ein, die das Eigentum als ökologisch eingebettete, kollektive Lebenspraxis denkt. So entsteht ein zukunftsfähiges Eigentumsverständnis, das über die übliche linke Kritik hinausweist und konkrete Alternativen im Hier und Jetzt erprobt.
Die Kernbotschaft der beiden Autoren lautet: Eine zukunftsfähige ökologische und demokratische Politik – so wie sie von ihnen im libertären Sinne verstanden wird – braucht mehr als nur abstrakte Theorien. Entscheidend ist die konkrete, für viele Menschen erfahrbare Vision eines besseren Lebens, denn:
„Es geht .( . .) nicht nur darum, in bestimmten radikalen und von der Mehrheitsgesellschaft abgesetzten Kommunen und Besetzungsprojekten Modelle einer möglichen lebenswerten Zukunft vorzuleben und einzuüben. Sondern es müsste auch inmitten der Metropolen, dort also, wo die Mehrheitsgesellschaft lebt und arbeitet, noch viel mehr als heute mit kleinen, lokalen Elementen eines besseren Lebens experimentiert werden. Ohne den Zwang, dafür gleich ganz aussteigen und ganz von der bürgerlichen Welt in eine andere übersiedeln zu müssen – ohne den Zwang zu tragischen Entscheidungen zwischen ‚drinnen‘ und ‚draußen‘. Überall wird es darum gehen, die verhärteten Dualitäten aufzuweichen, die zu derartigen Grundsatzentscheidungen führen. Denn weder die Reinheit des Gewissens noch das politische Engagement als solches eröffnet den Ausweg aus der Alternativlosigkeit, sondern die existenzielle Erfahrung eines anderen, eines besseren Lebens.“ (S. 141)
Durchlöchert den Status quo! ist ein ebenso inspirierendes wie streitbares Buch. Es lädt dazu ein, Utopien nicht nur zu erträumen, sondern sie als gelebte Experimente im Hier und Jetzt erfahrbar zu machen. Ein wichtiges Buch für all jene, die den ökologischen und gesellschaftlichen Wandel nicht den Kräften der Reaktion oder der Resignation überlassen wollen.
Jochen Schmück
Quelle: espero Nr. 9/10, Dezember 2024, S. 535-539.
Anmerkungen:
1 In P.M.s Utopie sind „Bolos“ kleine, autonome Gemeinschaften von 100 bis 500 Menschen, die sich freiwillig zu größeren Allianzen zusammenschließen können. Jede Einheit gestaltet ihr Leben selbstbestimmt – mit eigenen Moralvorstellungen, Rechtsnormen, Sexualpraktiken, Sprachgewohnheiten, Religionen, Ritualen usw. – ohne zentrale Kontrolle. Der Grad von Individualismus oder Kollektivität wird in jedem Bolo von seinen Bewohner:innen selbst bestimmt und ist lediglich durch die Notwendigkeit der Selbstversorgung und Gastfreundschaft beschränkt. Individuen wählen frei, welchem Bolo sie angehören, oder sie wandeln ein bestehendes Bolo um, oder sie gründen ein neues.
Quelle: espero Nr. 11, Juli 2025, S. 270-274.