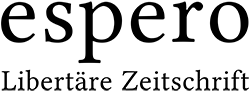Traum und Trauma. Die Besetzung und Räumung der Mainzer Straße 1990 in Ost-Berlin. Hrsg. von C. Bartlitz, H. Hochmuth, T. Koltermann, J. Saß und S. Stammnitz, Berlin: Ch. Links Verlag, 2020, Paperback, 144 Seiten, 978-3-96289-104-6, 20,00€ Machtvakuum und Sozialexperiment: Ost-Berlin im Jahr 1990 und die Besetzung der Mainzer Straße
Kein Staat kann durch den nächsten ersetzt werden, ohne dass Zwischenräume entstehen, die über den bloßen Herrschaftswechsel hinausweisen. Auch die friedliche Revolution in der DDR öffnete im November 1989 ein Zeitfenster für Praktiken der Selbstbestimmung, der freien Vereinbarung und Solidarität.

Die SED-Diktatur war gebrochen, die Volkspolizei hatte Autorität und Stärke verloren und die kapitalistische Ordnung des Westens war in Ostdeutschland noch nicht etabliert. Nicht von ungefähr standen die ersten großen Projekte deutsch-deutschen Zusammenlebens im Zeichen von libertärem Neubeginn. Mit der kollektiven Inbesitznahme leerstehenden Wohnraums knüpften sie an eine bewährte Tradition zivilen Ungehorsams an. So hatten schon früher junge Menschen beiderseits der Mauer um konkrete Alltagsbedürfnisse, um soziale Freiräume und um eine Neudefinition von Urbanität gekämpft. Jetzt erlebte der Häuserkampf eine stürmische Renaissance.
Bis zum Sommer 1990 wurden allein in Ost-Berlin rund 130 Altbauten neu besetzt, davon 90 im Bezirk Friedrichshain. Hochburg war hier die Mainzer Straße. Ihre bewegte Wendezeit thematisiert jetzt ein Sammelband aus dem Ch. Links Verlag. Er trägt den Titel Traum und Trauma und ist herausgegeben von Christine Bartlitz, Hanno Hochmuth, Tom Koltermann, Jakob Saß und Sara Stammnitz. Sie haben Zeitzeugeninterviews, bislang unveröffentlichte Fotografien und quellenreiche Essays zusammengetragen, die zu einem multiperspektivischen Rückblick einladen.
Ein Ansatz, der sich liest wie ein imaginärer Dialog sämtlicher damals beteiligter Seiten, wie ein Versuch des Entkrampfens nach drei Jahrzehnten mythenumrankter Verhärtung.
Daraus ist viel zu lernen: Über den Sog der Utopie und die Lebendigkeit des Neuanfangs, aber auch über die Fallstricke autoritärer Selbstgewissheit und die alles zerstörende Destruktivität der Gewalt.
Was die Mainzer Straße innerhalb kürzester Zeit zum Brennpunkt dieser Tendenzen machte, war ein ganz spezifisches Gebäude-Ensemble. „Fast die ganze westliche Straßenseite war Ende der 1980er-Jahre entmietet worden, weil der Ost-Berliner Magistrat die maroden Altbauten durch moderne Plattenbauten ersetzen wollte“ (S. 13 f.). Der Mauerfall vom 9. November 1989 legte nicht nur sämtliche Abrisspläne auf Eis. Er öffnete auch der subversiven Gegenöffentlichkeit grenzüberschreitende Dimensionen. Bürgerbewegte aus dem Osten und Autonome aus dem Westen bereiteten in einem kommunikativen Ping Pong die Initialzündung vor. Auf den Listen leerstehender Häuser, die bei der 1. Mai-Demonstration 1990 in Kreuzberg kursierten, stand die „Mainzer“ ganz oben. Schon wenige Tage später strömten hier etwa 250 Menschen – mehrheitlich aus West-Berlin und der Bundesrepublik – zusammen, besetzten einen ganzen Straßenzug von insgesamt zwölf benachbarten Häusern und fingen umgehend mit der erforderlichen Instandsetzung an.
Ein Quartier, das unterschiedlichsten Vorstellungen vom guten Leben einen Platz zur Entfaltung bot. „Diese Leute haben sich vorher in West-Berlin nicht mit dem Arsch angeguckt, sind nicht gemeinsam auf eine Demo gegangen. Doch durch das Besetzen der Mainzer Straße haben wir gemeinsam gehandelt. In unserem ‚kurzen Sommer der Anarchie‘ erschien uns alles möglich“ (S. 22). Verschiedene Gruppierungen der linksalternativen Szene bezogen jeweils ein eigenes Haus und machten die Mainzer Straße über Monate hinweg zu einem einzigartigen gesellschaftlichen Experimentierfeld.
Neben vielem anderen gab es das Sponti- und Spinnerhaus, es gab den Tuntentower, das Frauen- und Lesbenhaus oder das Wohnprojekt „Liebe – Luxus – Anarchie“. Es entstanden selbstverwaltete Formen kulturellen Lebens, sozialer Selbsthilfe, nachbarschaftlicher Orientierung und kooperativer Ökonomie: Sei es in der „Volxküche“, im Theatercafé „Nervensäge“, in der Schwulenkneipe „Forellenhof“, im linken Antiquariat „Max Hoelz“, in der Hiphop-Punk-Wochenend-Disco, im „Späti“ oder bei regelmäßigen Straßenfesten.
Die Einheit in der Vielfalt hatte für die Beteiligten allerdings auch ihren Preis. Zu gegensätzlich waren Sozialisation, Debattenkultur und Politikverständnis: „Aktivist*innen aus Ost-Berlin beschwerten sich über ‚Mackerverhalten‘ der Mitstreiter*innen aus dem Westen. Diese mokierten sich im Gegenzug über die vermeintliche ‚Naivität hinsichtlich der Gutmütigkeit des Staates‘ einiger Ost-Besetzer*innen“ (S. 129). Mit einer in manchen Zügen leninistisch anmutenden West-Borniertheit schauten Etliche auf Diejenigen herab, die gerade einen Staat gestürzt hatten und sich jetzt gegen zentralistische Strukturen im überbezirklichen Besetzer*innen-Rat wandten. „Für die Ost-Besetzer*innen war der Runde Tisch ein vertrautes Instrument, um einen Konflikt basisdemokratisch zu lösen“ (S. 130). Den westdeutschen Autonomen war diese Praxis weitgehend unbekannt. Ihr Widerstandskonzept gewann in der Mainzer Straße die Oberhand. Es ließ wenig Platz für Verhandlung, Dialog und Konsens, setzte stattdessen auf Konfrontation und Militanz.
Abwehrkämpfe gegen Neonazi-Attacken und zunehmende Auseinandersetzungen mit den Behörden setzten eine Gewaltspirale in Gang, unterwarfen die verbarrikadierten Häuser der Logik des Bürgerkrieges. Mit Inkrafttreten der neuen Staatsordnung am 3. Oktober 1990 ging die gesamtstädtische Exekutivgewalt auf die wesentlich besser ausgerüstete und räumungserfahrene West-Berliner Polizei über. Kurz darauf wurde das Exempel statuiert: Nach vorhergehenden Straßenschlachten begann am 14. November 1990 einer der massivsten und brutalsten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Reiner Zufall, dass es keine Toten gab. Mehr als 3000 Polizisten rückten gegen erbitterten Widerstand in die Mainzer Straße ein, räumten alle besetzten Häuser, zerstörten sämtliches Inventar und erklärten das Quartier zum Militärischen Sicherheitsbereich. Die brutale Machtdemonstration hatte weitreichende Folgen: Zerstörte Träume, verletzte Körper und Seelen. Traumatisierungen, die bei den Beteiligten bis in die Gegenwart nachwirken.
Für etwa zwei Drittel aller Häuser die 1989/90 in Berlin besetzt wurden, gelang es im Laufe der folgenden Jahre, Nutzungsverträge auszuhandeln. Noch heute beherbergen sie selbstverwaltete Wohn- und Kulturprojekte, Nachbarschaftszentren und Infoläden, sind Inseln von Kreativität und Subkultur. Drumherum ist der Wohnungsmarkt angespannter denn je.
Traum und Trauma ist ein Buch, das aktueller nicht sein könnte.
Markus Henning
Quelle: espero Nr. 4, Januar 2022, S. 307ff