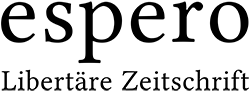Von Chiarra Bottici, übersetzt von Marie Beckmann, Berlin: März Verlag, 2024, ISBN: 978-3-7550-0037-2, 107 Seiten, 18,00 €.
Anarchafeminismus
„Wir leben in einer globalen Mannokratie. Mag sein, dass dass Patriarchat dem Untergang geweiht ist, mag sein, dass Männer nicht mehr das alleinige Familienoberhaupt stellen, aber sie sind immer noch das ‚erste Geschlecht‘“, beginnt Chiara Bottici wortgewaltig den Prolog in ihrem Anarchafeministischen Manifest. Das Feindbild „Mann“ wird dabei von ihr spezifiziert auf den Kollektivbegriff „Cis-Männer“, die in ihrer Sicht immer oben stehen und per se alle anderen Geschlechter und Sexualitäten unterdrücken. Diese Sichtweise entspringt ihrem Verständnis von Queerfeminismus, der für das von ihr propagierte Konzept von Anarchafeminismus grundlegend ist.
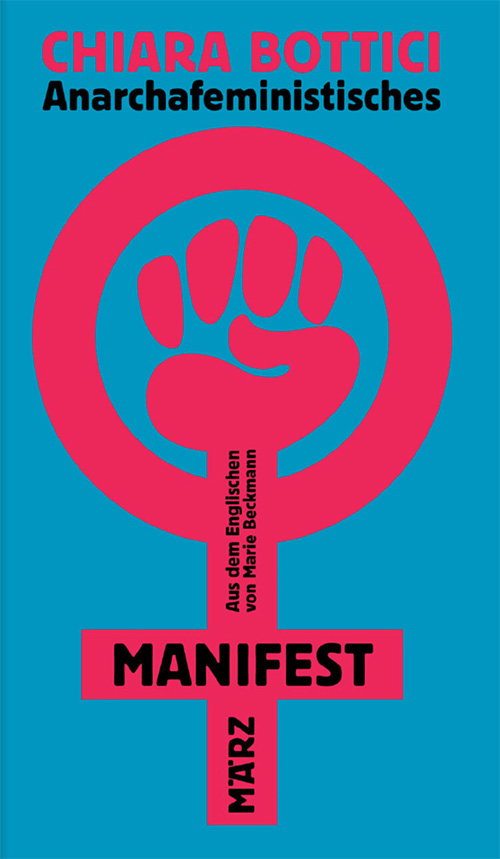
Der Anarchafeminismus als Begriff tauchte erstmalig in den 1970er Jahren in den USA auf. Er bezeichnete ursprünglich, d. h. in der Verwendung von Peggy Kornegger (Der Anarchismus und seine Verbindung zum Feminismus) oder Carol Ehrlich (Radikaler Feminismus und anarchistischer Feminismus), eine Verbindung von radikalfeministischen Positionen und den Grundannahmen des Anarchokommunismus nach Peter Kropotkin. Der Hintergrund jener Verbindung war, dass der Feminismus als Gesellschaftskonzept an seine Grenzen stieß und – ähnlich wie andere sog. schwache Ideologien – ein komplementäres Element benötigte, um eine grundlegende gesellschaftsverändernde Richtung einschlagen zu können.
Später wurde der Begriff dann erweitert – und auch Individualanarchist_innen wie die Kanadierin und Individualfeministin Wendy MacElroy werden mittlerweile darunter subsumiert. Ebenso wurden posthum diverse Anarchistinnen – trotz zum Teil antifeministischer Positionen – zu Vorläuferinnen erklärt – z. B. Louise Michel oder Emma Goldman. Mittlerweile scheint mir der Begriff immer inflationärer benutzt zu werden, ohne dass er klare Konturen aufweist und ein mehr oder weniger klar umrissenes Konzept beschreibt. Bottici erneuert dieses Konzept dahingehend, dass sie an die Stelle des Radikalfeminismus der 1970er Jahre den modernen Queerfeminismus setzt und Kropotkin durch Michael Bakunin austauscht.
Der Radikalfeminismus ging davon aus, dass gesellschaftliche Ungleichheiten vorrangig auf patriarchale Strukturen zurückzuführen seien. Der Queerfeminismus gilt als Weiterentwicklung dessen und setzt sich gegen die geschlechtliche Binarität und Heteronormativität ein.
Der von ihr benutzte Begriff des Queerfeminismus dient ihr als Sammelbegriff für alles, was sie politisch für relevant hält. Sie subsumiert kurzerhand (klassische) feministische, postkoloniale, posthumane und ökologische Theorien sowie Tierrechtsdiskurse unter Queerfeminismus – ohne deren eigenständige Theorieentwicklung und auch Abgrenzungen untereinander zu beachten bzw. zu würdigen. Für den Ökologieaspekt zitiert sie z. B. einen Beitrag des US-amerikanischen Philosophen Timothy Morton über Queer Ecology, der eine direkte Verbindung zwischen beiden Ansätzen postuliert und dabei Ökofeminismus und Queerfeminismus gleichsetzt, was sicherlich eine Minderheitenmeinung innerhalb des Spektrums darstellt.
Der von Bottici benutzte Ökologiebegriff ist jener der Tiefenökologie, einer umstrittenen Strömung innerhalb der Ökologiebewegung, die im anarchistischen Umfeld von der Earth First!-Bewegung oder der Ökofeministin Wicca Starhawk vertreten wird. Bedeutende und fundierte Kritiker_innen dieses Konzeptes sind u. a. Murray Bookchin und noch mehr Janet Biehl, die diesen Zugang für unvereinbar mit emanzipatorisch-feministischer Politik und Herrschaftskritik halten. Auch hier fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Konzept der Tiefenökologie.
Bottici, Philosophieprofessorin in New York und Mitleiterin des Gender and Sexualities Studies Institutes, stellt die Verbindung von diesem „Queerfeminismus“ und Anarchismus her, wobei sie den Anarchismus weitestgehend auf die durch Michael Bakunin personifizierte Staatskritik und einen diffusen Freiheitsbegriff reduziert. Bakunin ist neben Kornegger und der Autorin selbst auch die einzige Figur des Anarchismus, die im mehrseitigen Literaturverzeichnis auftaucht. Von insgesamt 57 Fußnoten verweisen nur drei (!) auf das Themenfeld Anarchismus. Ähnlich verhält es sich in der Literaturliste. Die vielfach von Feministinnen – nicht zuletzt von Silke Lohschneider (Anarchafeminismus – Auf den Spuren einer Utopie), aber auch schon von früheren Anarchafeministinnen – geäusserte feministische Kritik an Bakunin wird nicht einmal angesprochen. Nicht ohne Grund wurde die ursprüngliche Verbindung von Anarchismus und Feminismus über Kropotkin und nicht über Bakunin hergestellt. Egal wie man dazu steht, sollte man sich als erklärte_r Anarchafeminist_in hierzu verhalten, wenn man sich in dieser Tradition verortet.
Sie selber definiert Anarchismus, sich selbst zitierend – im Grunde genommen eine klassische Aussage von Pierre-Joseph Proudhon plagiierend – als „die Suche nach einer sozialen Ordnung ohne Ordnungsmacht.“ (S. 27). Es ist natürlich eines der strömungsübergreifenden Elemente, die sich sowohl im individualistischen Spektrum als auch im sozialen Anarchismus wiederfinden. Den Aspekt „soziale Ordnung“ füllt sie leider an keiner Stelle mit Leben.
Apropos Staatskritik. Sie erklärt: „Eines der wichtigsten Instrumente, mit denen Männer ihr Privileg aufrechterhalten und sicherstellen, dass sie das souveräne Geschlecht bleiben, ist der Staat“ (S. 19). Aus anarchistischer Perspektive kann ich dies unterschreiben, aber es ignoriert einen Teil der feministischen Traditionen – beginnend bei Christine de Pizan (Das Buch der Stadt der Frauen, 1405) bis hin zu Charlotte Gilman Perkins (Herland, 1915), d. h. die Konzepte feministischer Staatsutopien. Zudem bleibt dieser Begriff „Staat“ bei ihr oberflächlich und dient ihr vorrangig als Synonym für Herrschaft, was sicherlich zu kurz greift.
Alles in allem ist es enttäuschend, weil der Eindruck entsteht, dass sie nicht wirklich Ahnung von Anarchismus bzw. Anarchafeminismus hat. Eine Weiterentwicklung bzw. ein Weiterdenken des Anarchafeminismus findet nicht statt. Als queerfeministischer Text ist das vorliegende Manifest vielleicht von Relevanz, aber als „Anarchafeminismus“ ist es ein Etikettenschwindel. Hier werden einfach nur oberflächlich Schlagworte des Anarchismus (Staatskritik, Freiheit) mit einem ausgedehnten Begriff von Queerfeminismus gekoppelt, ohne dass eine adäquate Symbiose beider Konzepte, die sicherlich durchaus relevante Schnittmengen hätten, entsteht. Es bleibt alles etwas oberflächlich und partiell ahistorisch, was die Einordnung der Konzepte angeht.
Maurice Schuhmann
Quelle: espero Nr. 9/10, Dezember 2024, S. 521-524.