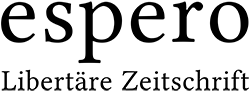Von David Graeber, Stuttgart: Klett-Cotta, 2016, gebunden, ISBN: 978-3-608-94752-6, 329 Seiten, 22,95 €.
„Bürokratie muss sein“ oder die „Phantasie an die Macht“?
Der bekennende Anarchist David Graeber war ein bedeutender Anthropologe und Vordenker der Occupy-Bewegung und Autor mehrerer anthropologischer und politischer Bücher, wie Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit. David Graeber starb am 2. September 2020 im Alter von 59 Jahren.
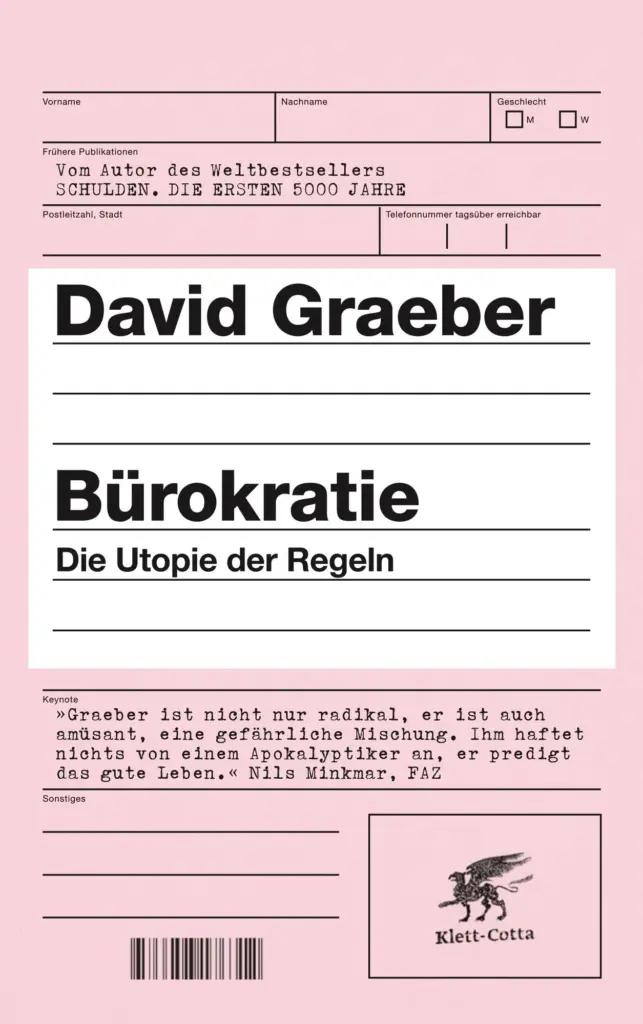
In seinem Buch Bürokratie. Die Utopie der Regeln vertritt Graeber die These, dass „dem Reiz der Bürokratie letztendlich die Angst vor dem Spielen“ zugrunde liegen würde – die Angst vor Willkür und Destruktivität, die jeder „ergebnisoffenen Kreativität“ innewohnen würden. Diese Furcht vor der Freiheit konterkariert Graeber auf den ersten Seiten mit einem Beispiel aus dem revolutionären Pariser Mai 1968, mit der seinerzeit vielleicht bekanntesten Parole „Die Phantasie an die Macht“.
Die antiautoritäre Jugendrevolte der 1960er Jahre veränderte und inspirierte die Linke. Man kritisierte die bürokratische Mentalität und Langeweile des modernen Wohlfahrtsstaates – ebenso die starre Bürokratisierung der staatssozialistischen Länder. Die jungen Rebellen dieses „Sommers der Anarchie“ favorisierten folgerichtig die Individualität und Spontanität. Wer brauchte eigentlich noch soziale Kontrolle und staatliche Regulierungen, wenn es um die Macht der Phantasie ging?
Nicht erst seitdem gilt Bürokratie als langweiliges und wenig zu beachtendes Phänomen, das in seiner Beschränktheit Sache staatlicher Behörden sei. Persönlich glauben alle – insgeheim – aber an die Notwendigkeit von Regeln, Gerechtigkeit und Ordnung. Wie sollte auch der Überblick behalten oder der Durchblick gewonnen werden?
David Graeber (1961-2020) ie mangelnde öffentliche Aufmerksamkeit für Bürokratie sei nach Graeber aber ungerechtfertigt, denn das Thema habe gesellschaftliche und politische Relevanz, denn es rage in sämtliche gesellschaftliche Bereiche hinein. Es müsse hier also um mehr gehen: Um nichts weniger als den Ausbruch aus dem „Stahlharten Gehäuse der Hörigkeit“, das Statement des Soziologen Max Weber, dass aus dem Charakter der modernen Technik ein ständiges bürokratisches Kontrollregime abzuleiten sei. Hier klingt ja für Libertäre schon mit durch, dass es nicht nur um bloße Technik gehen kann, dass Bürokratie vielmehr eine soziale und politische Technik totaler Herrschaft ist. Es müsse folglich um Möglichkeiten gehen, dieselbe aufzubrechen – also um ein „ur-anarchistisches“ Thema.
Im Zuge der Auflösung des traditionellen Wohlfahrtsstaates hat sich die Rechte (Motto „Der Markt regelt alles“) zielstrebig das Vokabular des antibürokratischen Individualismus angeeignet. Der Linken bleibt nichts anderes übrig, als in Rückzugsgefechten die Reste des Wohlfahrtsstaates zu verteidigen. Sie will deshalb den Staat „effizienter“ machen und Marktprinzipien in die bürokratischen Strukturen einschleusen. Das Ergebnis ist nach Graeber eine „politische Katastrophe“: Im Ergebnis werden gemäßigt-linke Lösungen für soziale Probleme aller Art präsentiert, was „eine albtraumhafte Verbindung der schlimmsten Elemente der Bürokratie mit den schlimmsten Elementen des Kapitalismus darstellt“.
Es verwundert nicht, dass jedes Mal, wenn eine soziale Krise ausbricht, die Rechte und nicht die Linke den Volkszorn zum Ausdruck bringt! Zumindest verfügt die Rechte über eine Bürokratiekritik – zwar sei sie schlecht, aber es gibt sie immerhin. Können Linke nichts Schlechtes über Bürokratie sagen, übernehmen sie zwangsläufig rechte Kritik.
Wie ist es zu alldem gekommen?
Ende des 19. Jahrhunderts wurden moderne bürokratische Verfahrensweisen auf den privaten Sektor übertragen, denn sie waren für große Unternehmen wesentlich effizienter als für kleine Familienunternehmen mit ihren persönlichen und informellen Beziehungen. Der Aufstieg der USA zur Weltmacht ging einher mit einer spezifischen amerikanischen Unternehmensstruktur, des korporativen, bürokratischen Kapitalismus. Die Amerikaner gingen daran, Staat und Unternehmen in gleicher Art und Weise zu organisieren. Als in den 1940er Jahren auf Kriegswirtschaft umgestellt wurde, folgte auch die riesige Bürokratie des US-Militärs diesem Vorbild. Schon lange verschwimmen die Grenzen zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich in den USA, wie z. B. Drehtüreffekte beim amerikanischen Militär zeigen. Ranghohe Offiziere aus dem Beschaffungswesen landen später regelmäßig im Vorstand der Unternehmen, die Militäraufträge erhalten. Nach Ende des Krieges im Jahr 1945 versuchten die USA, jeden und alles ihren Verwaltungsvorstellungen zu unterwerfen und schufen weltumspannende Bürokratien in Organisationen wie UNO, Weltbank, Internationaler Währungsfonds (IWF), Welthandelsorganisation (WTO) usw.
Mit dem Aufstieg des Finanzsektors hat diese Entwicklung ein qualitativ neues Niveau erreicht, denn es lässt sich praktisch nicht mehr feststellen, was öffentlich und was privat ist.
Vieles bewegt sich in einer Zwischenzone: Scheinbar privat, tatsächlich aber vollkommen staatlich festgelegt. Der Staat setzt den rechtlichen Rahmen und sichert Vorschriften durch das Rechtssystem. Dennoch arbeitet er eng mit privaten Konzernen zusammen, um eine bestimmte Profitrate für die Unternehmen zu gewährleisten. Im Bankenwesen bedeutete „Deregulierung“ den Übergang von einer geregelten Konkurrenz mittelgroßer Institute zu einem System, wo einigen wenigen großen Finanzkonglomeraten eine marktbeherrschende Stellung eingeräumt wurde. Keine Bank ist jedoch unreguliert, denn die Regierung reguliert alles: von der Höhe der Mindestreserven bis zu den Geschäftszeiten, legt die Zinssätze fest usw.
In den 1990er Jahren wurde die Globalisierung quasi als eine Naturgewalt dargestellt. Der technische Fortschritt, bzw. das Internet, vernetze die Welt wie nie zuvor. Wachsende Kommunikation und wachsender Handel schienen nationale Grenzen immer unbedeutender zu machen. Über Freihandelsabkommen würde man zu einem einzigen Weltmarkt kommen.
Die medial gepriesene Globalisierung hat aber nichts zu tun mit der Abschaffung von Grenzen, dem freien Verkehr von Menschen, Gütern und Ideen. Die wirkliche grenzenlose Welt steht gegen das bestehende Konzept bürokratisch abgesicherter Grenzen, hinter denen Sozialsysteme abgebaut werden können, um ein Arbeitskräftereservoir zu schaffen, das zu niedrigsten Löhnen arbeiten will und muss.
Der Sieg über den Staatssozialismus führte in Wirklichkeit nicht zur Herrschaft eines freien Marktes. Stattdessen klammerte man sich seitdem daran, dass der Kapitalismus das einzig mögliche System für eine hochkomplexe und technisch weit entwickelte Welt, wie die hiesige, sei.
Als die „Bewegung für globale Gerechtigkeit“ („Global Justice Movement“) aufkam, wurde sie in den Medien als ein Hirngespenst älterer, linker Spinner dargestellt, die Protektionismus, Handels- und Kommunikationsschranken errichten wollten. Das war abwegig, mit Blick auf das geringe Durchschnittsalter der Protestierenden. Sie bildeten ein Kaleidoskop ab von unterschiedlichsten Leuten aus aller Welt: indischen Bauern, kanadischen Postgewerkschaftern, Indigenen aus Panama, anarchistischen Kollektiven aus Detroit usw.
Die Medien wussten zu verhindern, dass diese Bewegung medial wirksam selbst zu Wort kam. Die gewalttätige Bildsprache der Polizeieinsätze hat dagegen alles, was bisher über die Globalisierung gesagt wurde, als Lüge entlarvt. Die Belagerung des Welthandelstreffens in Seattle im November 1999, später Blockaden des IWF und Weltbank, brachten die Problematik dieser globalen Bürokratien ins öffentliche Bewusstsein. Graeber stellt befriedigt fest, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren die Protestierenden fast neun vorgeschlagene Handelsabkommen zum Scheitern brachten.
Freihandel, freie Märkte sollten das erste effektive weltumspannende bürokratische System entfesseln. Nachdem nach und nach öffentliche und private Bürokratien zusammengewachsen waren, sodass man sie nicht mehr auseinanderhalten konnte – an der Spitze Handelsbürokratien wie IWF, Weltbank, WTO, G8-Gruppe, EU und NAFTA.
Die bürokratische Durchdringung des Alltagslebens (Bank- und Zahlungsgeschäfte durch Smartphones, PayPal, Amazon), die durch den Computer ermöglicht wurde, ist nicht das Ergebnis einer technologischen Entwicklung. Technologie entwickelt sich kontinuierlich, ihre allgemeine Richtung hängt aber von sozialen Faktoren ab. Zum Beispiel dem Verfall öffentlicher Infrastruktur. Nichts von dem geschah zufällig. Alles war eine Folge der Frage nationaler Prioritäten, Ergebnis politischer Entscheidungen, die festlegten, wohin die Mittel fließen. Der technische Wandel hat die Lage nicht verursacht, die Richtung ist eine Funktion der Macht des Finanzwesens – eben keine Folge neuer Technologien.
Eine linke Bürokratiekritik fehlt schmerzlich, so David Graeber, und dieses Buch soll auch kein Entwurf dazu sein. In keinerlei Hinsicht versucht es, eine allgemeine Kritik der Bürokratie auszuarbeiten: Es versammelt Ansätze und Perspektiven, die andeuten, in welche Richtung Bürokratiekritik gehen könnte. Eine aktuelle Bürokratiekritik müsse aufzeigen, wie sich alle Stränge, die Finanzialisierung, die Gewalt, die Technologie, die Verschmelzung des Öffentlichen und des Privaten, zu einem geschlossenen, sich selbst erhaltenden Netz verknüpfen. David Graeber stellt dazu Fragen: Ist Gesellschaftstheorie inzwischen überflüssig? Nein, stellt er fest, es gehe aber darum, um welche Gesellschaftstheorie es sich handelt und wozu sie dient. Ist vielleicht der Utopismus das Problem? Sich zuerst vorzustellen, wie eine bessere Welt aussehen kann, um sie dann in die Wirklichkeit umzusetzen? Ist schon die Vorstellung von Revolution aufzugeben?
Zumindest gibt es aber einen Trost: Dass, wenn mensch echte revolutionäre Freiheit erfahren will, mensch sofort damit beginnen kann. David Graeber nennt die Bewegungen der Situationisten und Anarchisten als Beispiele dafür, dass Freiheit nur im Augenblick einer Revolution entstehen kann. Diese Augenblicke sind nicht so selten. Revolutionäre Veränderung geschieht ständig und überall und jeder spielt darin eine Rolle, ob bewusst oder unbewusst.
Die Direkte Aktion, das trotzige Beharren darauf, so zu handeln, als wäre man bereits frei, bedeute aber nicht, quasi in einem einmaligen Akt die Erlösung zu erzeugen, sondern vielmehr eine Bewegung in Gang zu setzen, die auf die nachhaltige Abschaffung der Staaten und des Kapitalismus zielt. Im Ergebnis kann es in dieser Hinsicht aber keine absolute Sicherheit geben. Es erscheint gegenwärtig naiv zu glauben, dass ein erfolgreicher Bürgerkrieg den Apparat der strukturellen Gewalt außer Kraft setzen könne, jedenfalls nicht innerhalb eines bestimmten nationalen Territoriums. Tatsache ist jedoch, dass in bestimmten Situationen der Geschichte sich genau das abgespielt hat. Über die Beschaffenheit dieser revolutionären Momente lohne es sich, nachzudenken.1 Das gesamte anarchistische Projekt einer Neuerfindung der direkten Demokratie beruht darauf, dass diese tatsächlich möglich sein kann. Es stelle sich aber die Frage, wie vermieden werden kann, dass wieder neue bürokratische Apparate entstehen.
Die Antwort, weshalb inzwischen einiges besser möglich geworden sei, sieht Graeber im Feminismus. Dieser lehrt, dass es weniger darum geht, endzeitliche Träume zu realisieren, als vielmehr naheliegendes, was die Kraft der Phantasie langfristiger am Leben erhält.
Beispiele sind die Wirtschaftsgipfel zwischen 1999 und 2003, gegen die von der Global Justice Movement mobilisiert wurde. Der konkrete demokratische Planungsprozess der Aktionen war viel wichtiger, als die Aktionen selbst. Mehr noch galt dies für die Camps während des Arabischen Frühlings und schließlich für die Occupy-Bewegung in den USA. Alles erforderte eine Menge Arbeit und Anstrengungen, in der die Menschen ihre tief verwurzelte Trägheit überwinden mussten.
Deshalb lasst auf jeden Fall die Phantasie walten und zur Kraft in der menschlichen Geschichte werden, um die Technologien in den Dienst der Bedürfnisse der Menschen zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger. Fangen wir damit an!
Rolf Raasch
Anmerkungen
1 Siehe: Rolf Raasch: Soziale Revolution oder Rätedemokratie? Stellungnahmen zur Diskussion gestellt , in: espero (N. F.), Nr. 7 (Juli 2023), S. 257-271 (online | PDF).
Quelle: espero Nr. 9/10, Dezember 2024, S. 525-530.