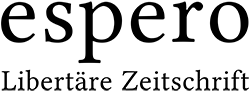Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit. Von David Graeber und David Wengrow, Stuttgart: Klett-Cotta, 2022, Gebunden mit Schutzumschlag, 672 Seiten, 978-3-608-98508-5, 28,00 € [Direktkauf bei aLibro]
Ein hoffnungsvoller Blick zurück nach vorn – Die Geschichte der Menschheit aus libertärer Sicht
Als der amerikanische Anthropologe und bekennende Anarchist David Graeber im Mai 2020 in einem Interview gefragt wurde, an welchem Buchprojekt er gerade arbeiten würde, da erwähnte er ein Buch, an dem er bereits ein ganzes Jahrzehnt lang gemeinsam mit seinem Freund, dem englischen Archäologen David Wengrow, gearbeitet hatte. Dieses Buch ist 2021 im englischen Original unter dem Titel The Dawn of Everything. A New History of Humanity erschienen, dem ein Jahr später auch die deutsche Übersetzung unter dem Titel Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit folgte.
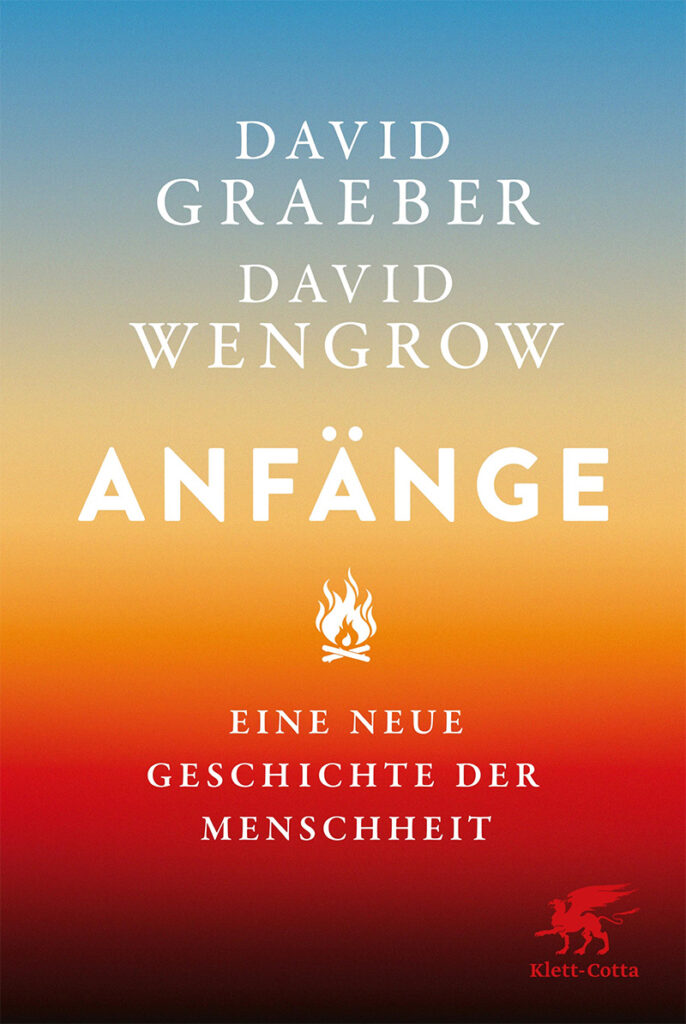
In seinem in espero, Nr. 2 (online | PDF), veröffentlichten Interview beschrieb Graeber damals das Buchprojekt als einen Versuch, mit dem er und sein Co-Autor Wengrow aufzeigen wollten, dass die Menschheitsgeschichte, wie sie seit den Zeiten von Jean-Jacques Rousseau typischerweise dargestellt wird, im Grunde genommen nur eine „säkularisierte Version der Bibel“ ist. Dazu Graeber wörtlich:
„Es gab Eden und dann gab es den Sündenfall. Zuerst lebten wir alle in glücklichen, egalitären Horden von Jägern und Sammlern. Das war Eden. Dann erfanden wir die Landwirtschaft, und alles ging den Bach runter. Wir bekamen Privatbesitz und ließen uns zum ersten Mal nieder. Und sobald wir Städte bekommen haben, bekamen wir auch Staaten und Reiche und Bürokratien und Überschussgewinnung [surplus extraction]. So bekamen wir auch die Schriftstellerei und die Hochkultur. Das alles kam als Paket nach dem Motto: Nimm es oder vergiss es.“
Und auf die etwas ungläubige Nachfrage des Interviewers, ob denn diese Darstellung falsch sei, erwiderte Graeber:
„Diese Darstellung ist faktisch falsch, sie beschreibt nicht einmal annähernd das, was historisch wirklich passiert ist. Denn eigentlich lebten die Jäger und Sammler nicht ausschließlich und auch nicht überwiegend in kleinen egalitären Gruppen von zwanzig oder dreißig Menschen. Vielmehr scheinen sie im Laufe der Geschichte zwischen kleinen Gruppen und kleinen Mikro-Städten hin- und hergewechselt zu sein. Sie haben wohl recht ausgeklügelte soziale Strukturen entwickelt, manchmal hatten sie sogar Polizei oder Könige, aber nur für einige Monate im Jahr. Dann zerstreuten sie sich und lebten wieder in kleinen Gruppen. Die Landwirtschaft bewirkte hier kaum einen Unterschied, und die frühen Städte waren eigentlich sehr egalitär“ (espero, Nr. 2, S. 103).
Graeber und Wengrow unternehmen also mit Ihrem Buch nichts Geringeres als den Versuch einer Neubeschreibung der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, wobei sie den Fokus ihrer Untersuchung auf jene „dunklen Zeitalter“ und Lücken der Geschichte legen, die von der bisherigen vorherrschenden Forschung stiefmütterlich behandelt wurden. Dieses ambitionierte Projekt einer neuen und aus einer libertären Perspektive geschriebenen Universalgeschichte der Menschheit hatte sich – wie sich David Wengrow in seinem Vorwort zum Buch erinnert – ursprünglich aus einem spielerisch betriebenen Experiment entwickelt, „in dem ein Anthropologe und ein Archäologe mit dem heute vorhandenen Quellenmaterial versuchten, den großen Dialog über die menschliche Geschichte wiederzubeleben“ (S. 7). Was als eine intellektuelle Ablenkung von den ernsteren akademischen Pflichten begonnen hatte, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem spannenden und fruchtbaren interdisziplinären Dialog zwischen zwei Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachgebieten.
Allein der dem Buch zugrundeliegende Ansatz zur Interdisziplinarität, mit dem die beiden Autoren archäologische Entdeckungen aus anthropologischer Sicht und anthropologische Forschungsergebnisse aus archäologischer Sicht betrachten, diskutieren und gemeinsam beschreiben, macht ihr Projekt ziemlich einzigartig, denn gewöhnlich besteht zwischen den Fächern Anthropologie und Archäologie nur selten der Wunsch zur Zusammenarbeit. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist eine ausgedehnte Reise in die Vergangenheit, die von Kontinent zu Kontinent und von einer sozialen Sphäre zur anderen springt, um uns eine andere Geschichte der menschlichen Kultur zu erzählen.
Der größte Teil des Buches führt uns von den Jäger- und Sammlergesellschaften der Eiszeit zu den frühen Staaten in Afrika, Eurasien und auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Dabei wird deutlich, dass Jäger- und Sammlergesellschaften in ihren sozialen Organisationsformen weitaus komplexer und flexibler waren, als wir es uns gemeinhin vorstellen.
So berichten die Autoren unter Berufung auf den französischem Anthropologen Claude Lévi-Strauss von einer indigenen Gesellschaft im Amazonasgebiet Brasiliens, die Nambikwara, die saisonal zwischen zwei völlig unterschiedlichen Formen der sozialen Organisation wechselte. Während der Trockenzeit lebten die Nambikwara in kleinen verstreut nomadisierenden Wildbeutergruppen, die von einem Häuptling angeführt wurden, der in dieser Zeit den „Boss“ spielte. So gab er Befehle, fand Krisenlösungen und verhielt sich auf eine Art autoritär, die während der Regenzeit von seinem Volk abgelehnt worden wäre. In der Regenzeit dagegen, in der eher Überfluss als Mangel herrschte, betrieben die Nambikwara Gartenbau und bildeten eine große egalitäre Dorfgemeinschaft von mehreren Hunderten von Einwohnern. Obschon sich also in der Regenzeit die Siedlungsgemeinschaft zahlenmäßig deutlich vergrößert hatte, war dies genau die Zeit, in der die Entscheidungen von der Dorfgemeinschaft kollektiv getroffen wurden. Häuptlinge konnten in dieser Saison ihr Volk nur mit schonend vorgetragenen guten Argumenten überzeugen oder auch indem sie mit gutem Beispiel vorangingen, um etwa ihre Gefolgsleute beim Bau ihrer Häuser und der Pflege ihrer Gärten anzuleiten. In dieser Funktion kümmerten sie sich auch um Kranke und Bedürftige, traten bei Streitigkeiten als Schlichter auf, aber sie konnten niemanden zu etwas zwingen.
Graeber und Wengrow räumen in ihrem Buch gründlich mit dem Ur-Mythos einer geradlinig, quasi evolutionär verlaufenden Entwicklungsgeschichte der Menschheit auf. Diesen Mythos gibt es in zwei Varianten: Die eine Variante besagt, dass das Leben als primitive Jäger und Sammler gemein, brutal und kurz war, bis uns die Erfindung der Landwirtschaft und die Entstehung der Zivilisation den Staat bescherte, durch welchen wir zu Ordnung und Wohlstand kamen. Die andere Variante des Mythos geht davon aus, dass wir, die Menschen, als Jäger und Sammler anfänglich in einem Zustand „kindlicher Unschuld“ glücklich und frei, sozusagen in paradiesischen Zuständen, lebten, und dass wir erst mit dem Aufkommen von Landwirtschaft und Zivilisation „blind auf unsere ‚Ketten‘ losrannten“ (S. 160). Egal, ob wir uns nun für die erste, etatistische Variante des Mythos entscheiden (für die Thomas Hobbes steht), oder ob wir eher der zweiten anarchistischen Variante zustimmen (für die Jean-Jaques Rousseau steht), stets kommen wir zu dem gleichen Ergebnis, dass Hierarchie und Ungleichheit der unvermeidliche Preis sind, den wir dafür zahlen müssen, dass wir als Menschen schließlich „erwachsen“ und „zivilisiert“ geworden sind. Dieser Prozess der Zivilisierung der Menschheit war zwar mit einem Verlust an individueller Freiheit verbunden, doch er brachte auch all die Errungenschaften der Zivilisation wie Literatur, Kunst, Wissenschaft und Philosophie hervor. Zugleich kam jedoch auch „fast alles Schlechte in die Welt: das Patriarchat, stehende Heere, Massenhinrichtungen und nervige Bürokraten, die von uns verlangen, dass wir den größten Teil unseres Lebens damit verbringen, Formulare auszufüllen“ (S. 14).
Diesem Mythos in seinen zwei Sichtweisen von der Entwicklungsgeschichte der Menschheit widersprechen die beiden Autoren vehement, und sie belegen anhand zahlreicher Beispiele, dass menschliche Gesellschaften bereits vor der Entstehung der Landwirtschaft nicht auf kleine, egalitäre Gruppen beschränkt gewesen sind.
„Ganz im Gegenteil – schon zuvor fanden in der Welt der Jäger und Sammler mutige soziale Experimente statt, die weit mehr einem Karnevalszug politischer Formen glichen als den öden Abstraktionen der Evolutionstheorie. Die Landwirtschaft wiederum war nicht mit der Entstehung des Privateigentums verbunden, und sie bedeutete keineswegs einen irreversiblen Schritt Richtung Ungleichheit“ (S. 16).
Viele der frühen Städte, bei denen es sich um Ansiedlungen mit Tausenden von Einwohnern handelte, weisen keinerlei Anzeichen einer zentralisierten Verwaltung auf. Es gibt in ihnen keine Paläste, keine Gemeinschaftslager, keine offensichtlichen Unterscheidungen nach Rang oder Reichtum. Dies gilt schon für das vielleicht älteste urbane Siedlungsgebiet der Menschheit, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine entstandene „Megastätte“ der „Trypillja-Kultur“ bei Taljanky, die erst in den 1970er Jahren entdeckt wurde und deren Entstehung auf etwa 4100 v. Chr. datiert wird. „Nach herkömmlichen politischen Vorstellungen ließ sich dort offenbar keine Zentralregierung oder Verwaltung nachweisen – geschweige denn eine herrschende Klasse“ (S. 317), und es gibt auch „keinerlei Belege für Monarchen oder Kriegereliten und somit sei es wahrscheinlich, dass sich Institutionen kommunaler Selbstverwaltung entfalteten“ (S. 350).
Ebenso wie in der Megastätte bei Taljanky scheint in der um 3300 v. Chr. gegründete Stadt Uruk in Mesopotamien ein explizites Gleichheitsethos bestanden zu haben, das die Autoren wie folgt definieren:
„Ein bewusstes Gleichheitsethos kann zu jedem Zeitpunkt der Geschichte eine von zwei diametral entgegengesetzten Formen annehmen. So kann man darauf pochen, alle Menschen seien genau gleich oder sollten es sein (zumindest in den Bereichen, die wir für wichtig erachten). Oder man besteht darauf, alle Menschen unterschieden sich so sehr voneinander, dass es schlicht keine Kriterien für einen Vergleich gebe (zum Beispiel sind wir alle einzigartige Individuen, weshalb es nicht plausibel ist, einen Menschen als besser zu betrachten als einen anderen). Im wirklichen Leben schließt Egalitarismus in der Regel ein bisschen von beidem ein“ (S. 351).
Offensichtlich verkörperte Uruk in Mesopotamien, mit seinen standardisierten Haushaltsprodukten, einheitlichen Zahlungen an Tempelangestellte und öffentlichen Versammlungen weitgehend die erste Erscheinungsform des Gleichheitsethos. Die Megastätte bei Taljanky, in denen anscheinend jeder Haushalt seinen eigenen künstlerischen Stil und vermutlich auch eigene häusliche Rituale entwickelte, steht hingegen für die zweite Erscheinungsform.
Das überzeugendste Beispiel für städtischen Egalitarismus ist für die Autoren zweifellos Teotihuacán, eine mesoamerikanische Stadt, deren eindrucksvolle Ruinenstätte sich in der Nähe von Mexiko-Stadt befindet. In Größe und Pracht konnte Teotihuacán durchaus mit dem kaiserlichen Rom, ihrem Zeitgenossen, konkurrieren. Der Überlieferung zufolge wurde Teotihuacán um das Jahr Null v. Chr. von einem Zusammenschluss von Ältesten, Priestern und Weisen aus anderen Siedlungen gegründet, und sie wird heute als eine der bedeutendsten Ruinenstätte in der Geschichte der Kulturen Mexikos betrachtet. Das Höhlensystem und die Ruinen von Teotihuacán umfassen ein riesiges Areal, das zu seinen „Glanzzeiten“ vermutlich aus 75 Tempeln und 600 Werkstätten bestand. Die von Hundertausenden von Einwohnern bewohnte Stadt war damals das größte kulturelle und geistig-religiöse Zentrum Mesoamerikas, das über seine Handelsbeziehungen auch kulturellen und politischen Einfluss auf weit entfernte Völker wie die Maya ausübte, die das Gebiet der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatán sowie das Territorium des heutigen Guatemala, von Belize, Honduras und El Salvador besiedelten.
Anfänglich konzentrierten sich die Bemühungen der Bewohner von Teotihuacán auf den Bau einer heiligen Stadt inmitten des weitläufigen Stadtgebiets, in dem sie viele monumentale Bauten, darunter auch die berühmte große Sonnenpyramide und die etwas kleinere Mondpyramide, errichteten und künstliche Flüsse anlegten. Diese aufwendige Bautätigkeit forderte ihren Tribut, auch an Menschenleben, denn wie die archäologischen Zeugnisse belegen, war jede wichtige Bauphase von Teotihuacán mit rituellen Menschenopfern verbunden. Um 200 n. Chr. hatte es den Anschein, als hätte sich Teotihuacán in die Tradition der klassischen mesoamerikanischen Zivilisationen mit ihren Kriegeraristokratien und Stadtstaaten eingereiht. Doch die archäologischen Zeugnisse erzählen eine ganz andere Geschichte, denn die Einwohner der Stadt schlugen einen anderen Weg ein, den die Autoren wie folgt beschreiben:
„Statt Paläste und Eliteviertel zu bauen, begannen die Bewohner mit einem erstaunlichen Stadterneuerungsprojekt, das unabhängig von Reichtum und Status für fast die gesamte Bevölkerung hochwertigen Wohnraum bereitstellte. (. . .) Die große Wende im Schicksal der Stadt setzte offenbar um etwa 300 n. Chr. ein. Damals oder kurz danach entweihte man den Tempel der Gefiederten Schlange und plünderte die Vorratskammern mit den Opfergaben. Nicht nur den Tempel setzte man in Brand, auch viele der Köpfe der Gefiederten Schlange an seiner Fassade, die wie Wasserspeier aussahen, wurden zerschlagen oder bis auf einen Stumpf abgeschliffen. (. . .) Nach dem Brand des Tempels wurde der Bau neuer Pyramiden endgültig eingestellt, und für rituell sanktionierte Tötungen an der zuvor errichteten Sonnen- und der Mondpyramide gibt es keine weiteren Zeugnisse mehr. Beide Pyramiden blieben als städtische Monumente weiter in Gebrauch, dienten aber anderen, weniger gewaltsamen Zwecken, über die wir nur wenig wissen. Stattdessen ist erkennbar, dass enorme Mittel in den Bau ausgezeichneten gemauerten Wohnraums flossen, der nicht nur den Wohlhabenden und Privilegierten, sondern den meisten Einwohnern zugutekam. (. . .) Viele Archäologen hielten die gemauerten Wohnungen zunächst für Paläste, und es ist gut möglich, dass sie es anfänglich, um etwa 200 n. Chr., auch waren, als die Stadt allem Anschein nach auf eine starke politische Zentralisierung zusteuerte. Nach 300 jedoch, nachdem der Tempel der Gefiederten Schlange entweiht war, setzte man ihren Bau in hohem Tempo fort, bis die meisten der etwa 100 000 Einwohner der Stadt in der Tat unter ‚palastartigen‘ oder doch sehr komfortablen Bedingungen lebten. (. . .) Mit anderen Worten, in dieser Stadt gab es nur wenig sozial Schwache. Mehr noch, viele Bürger hatten einen bisher unbekannten Lebensstandard, wie ihn auch in unseren heutigen Städten nur selten ein so großer Anteil der städtischen Gesellschaft erreicht“ (S. 369 f.).
Da keine schriftlichen Zeugnisse existieren, werden sich die Details der politischen Ordnung in Teotihuacán vielleicht niemals genau rekonstruieren lassen, aber nach Ansicht der Autoren können wir ziemlich sicher jede Art von hierarchischem System ausschließen, in dem elitäre Kader königlicher Verwalter oder Priester Pläne ausgearbeitet und Befehle erteilt hätten. Die politische Autorität und Verwaltung der kommunalen Angelegenheiten dürfte auf lokale Versammlungen von Nachbarschaftsräten verteilt gewesen sein.
Anhand von Beispielen aus zahlreichen anderen Kulturen belegen Graeber und Wengrow in ihrem Buch, dass bereits in der Welt der Jäger und Sammler mutige soziale Experimente stattfanden, die sich nur schwer mit dem Mythos einer geradlinig verlaufenden, quasi evolutionären Entwicklungsgeschichte der Menschheit in Einklang bringen lassen. Gleichzeitig räumen die Autoren des Buches gründlich mit dem Mythos auf, dass die Einführung der Landwirtschaft zwangsläufig zur Entstehung des Privateigentums sowie von Ungleichheit und politischen Herrschaftssystemen führen musste:
„In Wirklichkeit waren viele der ersten landwirtschaftlichen Gemeinden relativ frei von Rängen und Hierarchien. Und eine überraschend große Zahl der ersten Städte auf unserem Planeten war weit davon entfernt, Klassenunterschiede in Stein zu meißeln. Sie waren in robusten egalitären Strukturen organisiert – ohne Bedarf an autoritären Herrschern, ehrgeizigen Krieger-Politikern oder auch nur herrischen Verwaltern“ (S. 16).
Die in ihrer Fülle an historischen Beispielen beeindruckende Studie von Graeber und Wengrow macht deutlich, dass es in der Geschichte der Menschheit kein „goldenes Zeitalter“ der Freiheit und Gleichheit gegeben hat. Stattdessen gab es immer wieder Zeiten, in denen einige Gesellschaften ihr Leben nach libertär-egalitären Prinzipien organisiert haben, während zur gleichen Zeit ihre Nachbarn düstere Epochen durchlebten, in denen die politische Macht in den Händen weniger monopolisiert gewesen ist, die daraus ihre wirtschaftlichen Vorteile gezogen haben. Ihr Buch zeigt aber auch, dass solche politischen Sackgassen, in denen sich die Menschheit in ihrer Geschichte immer wieder verfangen hat, nicht das unvermeidliche Resultat eines evolutionär verlaufenden Entwicklungsprozesses gewesen sind. Denn es gibt auch den Weg zurück aus der Sackgasse des Autoritarismus und der sozialen Ungleichheit, und das ist vielleicht die wichtigste, weil hoffnungsvollste Botschaft des Buches.
Das Buch war leider Graebers letztes Buchprojekt, denn am 2. September 2020, gerade mal drei Wochen nach Abschluss des Buchmanuskriptes, ist der für den modernen Anarchismus so bedeutsame Autor und Aktivist im Alter von 59 Jahren in Venedig plötzlich verstorben. Es war sein libertäres Verständnis von präfigurativer Politik, das die Essenz von Graebers Anarchismus bildete. Statt für eine ferne anarchistische Zukunft zu kämpfen, ging es ihm darum, Freiräume für eine gelebte Anarchie im Hier und Jetzt zu schaffen. Dieser praxisorientierte Ansatz von Graebers Anarchismusverständnis zeigt sich wohl am deutlichsten in der Rolle, die er in der internationalen Occupy-Wall-Street-Bewegung spielte, die maßgeblich durch ihn geprägt wurde. So ist es seinem Einfluss zu verdanken, dass die Occupy-Bewegung libertäre Organisationsformen – einschließlich direkter Demokratie, Sprecherräte, Konsensentscheidungen und Affinitätsgruppen – annahm und dass die Protest-Camps der Bewegung anarchische Räume bildeten, die ohne eine zentralisierte Autorität eingerichtet und betrieben wurden. In Graebers libertärem Organisationsmodell und in der anarchistischen Art der Entscheidungsfindung, die er in die Bewegung einbrachte, lässt sich deutlich der Background der anthropologischen und soziologischen Erkenntnisse erkennen, auf denen sein Verständnis von Anarchie und Anarchismus beruht. Damit steht er in der Tradition des modernen pragmatischen Anarchismus, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg von Colin Ward und Nicolas Walter in England begründet wurde. So wie diese beiden Vordenker des modernen Anarchismus stand auch Graeber den traditionellen Strömungen des Old-School-Anarchismus – wie Anarcho-Kommunismus und Anarcho-Syndikalismus – eher kritisch gegenüber. Seiner Ansicht nach waren solche den Anarchismus in seinem Handlungsspielraum einengenden Lesarten seiner Ideologie zu starr und auch zu isoliert angelegt, was sie für die breite Mehrheitsgesellschaft unattraktiv machte. Graebers pragmatischer Anarchismus war dagegen spielerisch und inklusiv angelegt, um Raum für den Einzelnen zu schaffen, die Welt nach seinen politischen Überzeugungen und Werten zu gestalten.
Auch wenn die Sympathien von Graeber und seinem Co-Autor Wengrow deutlich erkennbar bei den freiheitlich-egalitären Gemeinwesen liegen, so leiten sie aus ihren historischen Erkenntnissen doch kein eindeutiges Plädoyer für den Anarchismus ab. Stattdessen möchten sie mit ihrer aus libertärer Sicht geschriebenen Entwicklungsgeschichte der Menschheit das Geschichtsbild ihrer Leserschaft erweitern, um dem gesellschaftlichen Dialog über freiheitliche Alternativen zu den bestehenden Gesellschaftssystemen neuen Schwung zu verleihen. Wenn „wir Menschen uns den größten Teil unserer Geschichte fließend zwischen verschiedenen Sozialordnungen hin- und herbewegt haben, wenn wir regelmäßig Hierarchien aufgebaut und wieder abgebaut haben“ (S. 135), dann sollten wir nach Ansicht von Graeber und Wengrow auch sinnvollerweise nach Antworten auf die folgenden Fragen suchen:
„Wie sind wir stecken geblieben? Wie sind wir bei einer einzigen Ordnung gelandet? Wie haben wir das politische Bewusstsein verloren, das für unsere Spezies einst so typisch war? Wie kommt es, dass wir hohes Ansehen und Unterwürfigkeit als unentrinnbare Elemente des menschlichen Daseins betrachten und nicht mehr als befristete Notlösungen oder gar als Pracht und Herrlichkeit einer großartigen saisonalen Theateraufführung? Wenn wir anfangs nur gespielt haben, wann haben wir vergessen, dass wir spielten?“ (S. 135).
Aus den Erkenntnissen heraus, die sie bei ihrer Arbeit an dem Buch gewonnen haben, wagen die Autoren schließlich zum Ende ihres Buches doch noch einen fast hoffnungsvollen Ausblick auf eine Zukunft und Gesellschaft, die in der Lage ist, eine moderne Kultur der Freiheit und Solidarität zu entwickeln, so wie sie in der Geschichte der Menschheit immer wieder zum Vorschein gekommen ist und über lange Epochen hinweg das Leben der Menschen geprägt und bereichert hat:
„Wer weiß? Womöglich werden wir, wenn unsere Spezies überlebt, eines Tages auf diese heute noch unvorhersehbare Zukunft zurückblicken und Aspekte der fernen Vergangenheit, die heute wie Anomalien wirken – Bürokratien, die im Gemeindemaßstab arbeiten; Städte, die von Nachbarschaftsräten regiert werden; Regierungssysteme, in denen Frauen eine Mehrheit der offiziellen Posten bekleiden; Formen der Landverwaltung, die eher auf Pflege als auf Besitz und Ausbeutung beruhen –, als die wirklich bedeutenden Durchbrüche erkennen und große Steinpyramiden oder Statuen eher für historische Kuriositäten halten. Wie wäre es, wenn wir diesen Ansatz jetzt schon wählten und [die in dem Buch aufgeführten Beispiele freiheitlich-egalitärer Gemeinwesen] nicht mehr nur als zufällige Schlaglöcher auf einem Weg betrachteten, der unvermeidlich zur Bildung von Staaten und Imperien führt, sondern als alternative Möglichkeiten, als Wege, die wir nicht eingeschlagen haben?“ (S. 557f.).
Jochen Schmück
Quelle: espero Nr. 6, Januar 2023, S. 254-263.